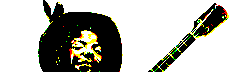

Ein Banjo ist ein Banjo ist ein Banjo? Mitnichten! Banjos gab und gibt es in zahlreichen Varianten, mit 4, 5, 6 oder gar 8 Saiten, in Größen von klein bis unhandlich und mit Hälsen von 0 bis 25 Bünden. (Wer's nicht glaubt, schaue mal bei Günter Amendt im Schauraum nach :-)
Wenn das Ding ein Fell hat, das über eine Art von Topf gespannt wird und auf dem ein Steg steht, über den die Saiten laufen, dann handelt es sich um ein Banjo. Ausnahmen bestätigen die Regel, z.B. die elektrischen Banjos, die Gibson oder Rickenbacker mal herstellten (Holzplatte statt Fell) oder das ebenfalls elektrische Vollholzbanjo von Terry Swan. In den vergangenen 150 Jahren wurde das Banjo technisch ständig verbessert. Dabei waren die Bastler immer dann besonders erfinderisch, wenn das Banjospiel gerade in Mode war. Das lässt sich wunderschön an den darauf erteilten Patenten ablesen.
Die erste Erwähnung eines Banjos in der neuen Welt stammt aus dem Jahre 1678. Ironischerweise war es ein Verbot. Die Schwarzen der Insel Martinique sollten das Tanzen und Spielen des Banza bleiben lassen. Doch das Banjo war nicht mehr aufzuhalten. 1781 erwähnt es sogar der spätere Präsident Thomas Jefferson aus Virginia. Demnach hatte es vier Saiten! Die fünfte Saite soll angeblich der weiße Minstrelsänger Joel Walker Sweeney in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfunden haben. Ob es sich dabei um die kurze G-Saite oder die Basssaite handelte, ist heute umstritten.
Eine erste Erwähnung eines mit Plektrum gespielten Banjos datiert auf die späten 1880er und 1890er Jahre. Es sollen Theatermusiker gewesen sein, die auf diesen Trick kamen und dazu die fünfte Saite abmontierten. So ab der Jahrhundertwende trugen die Hersteller diesem Trend Rechnung und produzierten das 4-saitige Plektrumbanjo.
Das Tenorbanjo hat - glaubt man den Büchern von Karen Linn und Robert Lloyd Webb - eine interessante Geschichte. Im Jahre 1880 tourte eine Gruppe spanischer Studenten mit großem Erfolg durch die USA. Sie sangen und spielten dazu die Bandurria, ein traditionelles spanisches Instrument. Das kam bei den amerikanischen Studenten offenbar unheimlich gut an und so starteten sie eigene Gruppen in diesem Stil, spielten aber statt der Bandurria lieber Mandoline. Die war mit ihren 4 mal 2 Saiten ja auch leichter zu bewältigen als die 6 mal 2 Saiten der Bandurria und sah trotzdem fast genau so aus. Schon 1885 wurde dann das erste Mandolinenbanjo patentiert, richtig populär wurde es ab 1890. Typisch ist das über den Kessel reichende, erweiterte Griffbrett. In den Jahren etwa ab 1910 erwies sich das Mandolinenbanjo als geeignetes Begleitinstrument in der Tanzmusik. Lediglich die durch die Doppelbesaitung erzeugten Effekte störten die Profis und sie ließen in bewährter Manier die Parallelsaiten einfach weg. Das rief alsbald die Hersteller auf den Plan, die ein viersaitiges, wie die Mandoline gestimmtes Banjo anboten und Banjolin nannten. Leider war Banjolin aber ein seit 1885 patentierter Begriff für ein Mandolinenbanjo. Also behalf man sich mit Namen wie melody banjo oder soprano banjo. Damit kommen wir zu einem Phantom. Zwar gibt es allerlei Zitate dazu, doch nirgendwo konnte ich es in einem Katalog, geschweige denn in echt orten. Als ab 1912 in Amerika das Tangofieber grassierte, so will es die Sage, schob Vega unter der Bezeichnung Tangobanjo noch eine um eine Quinte tiefer gestimmte Variante nach. Dieses Banjo hatte anfangs mit 15 Bünden noch den kurzen Hals der Banjolin, wurde aber bald auf 17 und schließlich auf 19 Bünde gestreckt, wofür sich ab 1915 langsam die Bezeichnung Tenorbanjo durchsetzte.
Interessant ist auch noch die recht unterschiedliche Bedeutung der Banjoarten in den zwanziger Jahren. So weist beispielsweise der Gibson Katalog von 1927 acht Seiten mit Tenorbanjos auf, während sich Plektrumbanjo und fünfsaitiges Banjo mit jeweils einer Seite am Ende begnügen müssen.
![]() Das
fünfsaitige Banjo
ist die Urform des amerikanischen Banjos. Es leitet sich von Instrumenten
afrikanischen Ursprungs mit ähnlich lautenden Namen ab. Seit dem frühen 19.
Jahrhundert wird das heutige 5-string Banjo in Amerika gespielt - anfangs ohne,
später mit 22 Bünden. Die 5. Saite setzt neben der Basssaite in der Halsmitte
beim 5. Bund an und wurde ursprünglich nicht gegriffen (von modernen,
zeitgenössischen Banjospielern wird sie sehr intensiv gegriffen). Der
Felldurchmesser ist i.a. um die 11 Zoll. Die übliche Stimmung ist
gCGHD
(klassisch) und gDGHD (bluegrass). Gespielt
wird das fünfsaitige Banjo mit den Fingern (klassisch,
Frailing, Clawhammer) und mit Fingerpicks (3-Finger Bluegrass Stil).
Das
fünfsaitige Banjo
ist die Urform des amerikanischen Banjos. Es leitet sich von Instrumenten
afrikanischen Ursprungs mit ähnlich lautenden Namen ab. Seit dem frühen 19.
Jahrhundert wird das heutige 5-string Banjo in Amerika gespielt - anfangs ohne,
später mit 22 Bünden. Die 5. Saite setzt neben der Basssaite in der Halsmitte
beim 5. Bund an und wurde ursprünglich nicht gegriffen (von modernen,
zeitgenössischen Banjospielern wird sie sehr intensiv gegriffen). Der
Felldurchmesser ist i.a. um die 11 Zoll. Die übliche Stimmung ist
gCGHD
(klassisch) und gDGHD (bluegrass). Gespielt
wird das fünfsaitige Banjo mit den Fingern (klassisch,
Frailing, Clawhammer) und mit Fingerpicks (3-Finger Bluegrass Stil).
Einsatz: amerikanische Volksmusik, Minstrel, Salonmusik um 1900, Folk, Bluegrass, vereinzelt auch Pop und Modern Jazz.
![]() In
den 1970er Jahren erfand Pete Seeger die
long-neck
Version mit 25 Bünden, indem er den Hals am Sattel um 3 Bünde verlängerte und so
die Stimmung um eine kleine Terz erniedrigte. Mit Capo hinter Bund 3 ist das
long-neck Banjo also ein normaler Fünfsaiter und wird auch so gespielt.
In
den 1970er Jahren erfand Pete Seeger die
long-neck
Version mit 25 Bünden, indem er den Hals am Sattel um 3 Bünde verlängerte und so
die Stimmung um eine kleine Terz erniedrigte. Mit Capo hinter Bund 3 ist das
long-neck Banjo also ein normaler Fünfsaiter und wird auch so gespielt.
Einsatz: Folk
![]() Um
die Zeit der ersten "Banjoblüte", zwischen 1880 und 1900, entstanden zahlreiche
Varianten des fünfsaitigen Banjos in verschiedenen Größen. Besonders tat sich
hierbei S.S. Stewart hervor. Sein Piccolobanjo ist eine Minivariante des
5-saitigen Banjos mit 7" Kessel, 15 Bünden (bei 10" Halslänge) und, der Größe
entsprechend, eine Oktave höher gestimmt.
Um
die Zeit der ersten "Banjoblüte", zwischen 1880 und 1900, entstanden zahlreiche
Varianten des fünfsaitigen Banjos in verschiedenen Größen. Besonders tat sich
hierbei S.S. Stewart hervor. Sein Piccolobanjo ist eine Minivariante des
5-saitigen Banjos mit 7" Kessel, 15 Bünden (bei 10" Halslänge) und, der Größe
entsprechend, eine Oktave höher gestimmt.
![]() Auch
das (oder heißt es die?) Banjeaurine entstand 1885 in der Werkstatt von
S.S. Stewart. Gelegentlich findet sich auch die andere Schreibweise Banjorine.
Mit dem riesigen 12" oder 13" Kessel und dem vergleichsweise kurzen, über den
Kessel verlängerten Hals, wirkte es etwas unproportioniert. Die Stimmung war
eine Quart höher.
Auch
das (oder heißt es die?) Banjeaurine entstand 1885 in der Werkstatt von
S.S. Stewart. Gelegentlich findet sich auch die andere Schreibweise Banjorine.
Mit dem riesigen 12" oder 13" Kessel und dem vergleichsweise kurzen, über den
Kessel verlängerten Hals, wirkte es etwas unproportioniert. Die Stimmung war
eine Quart höher.
Er hatte sogar ein fünfsaitiges Bassbanjo im Programm, das mit seinem 18" Hals, 17" Kessel und 36 Spannschrauben ein wildes Gerät gewesen sein muss. Gestimmt war es in C, eine Oktave unter der Standardstimmung.
Einsatz: Alle diese Exoten wurden in Banjoorchestern eingesetzt, wie das Foto "banjo ensembles" auf der Mugwumps Seite über die S.S. Stewart Banjos beweist. Heute haben diese Instrumente nur noch als Sammlerstücke Bedeutung.
![]() Der
Hals hat wie bei seinem fünfsaitigen Vorfahr 22 Bünde und der gebräuchliche
Felldurchmesser ist 11 Zoll. Die Stimmung CGHD
ist vom Standardbanjo übernommen, gelegentlich findet man auch die von der
Gitarre abgeleitete Chicago-Stimmung DGHE,
manchmal auch EbAbCF
oder die auf den 5-string Banjos häufige Open G Stimmung
DGHD. Grifftabellen gibt es bei
banjoseen.com oder Jim Bottorf.
Der
Hals hat wie bei seinem fünfsaitigen Vorfahr 22 Bünde und der gebräuchliche
Felldurchmesser ist 11 Zoll. Die Stimmung CGHD
ist vom Standardbanjo übernommen, gelegentlich findet man auch die von der
Gitarre abgeleitete Chicago-Stimmung DGHE,
manchmal auch EbAbCF
oder die auf den 5-string Banjos häufige Open G Stimmung
DGHD. Grifftabellen gibt es bei
banjoseen.com oder Jim Bottorf.
Einsatz: Klassischer Jazz, Solo-Banjo
![]() Das
heutige Tenorbanjo ist bis auf Hals, Steg und Saitenhalter baugleich mit dem
Plektrumbanjo und fünfsaitigen Banjo, das heißt Felldurchmesser 11". Gestimmt
ist es aber in Quinten, CGDA
. Gespielt wird mit Plektrum. Eine Grifftabelle zum Tenorbanjo gibt
es bei
Ulrik Rathschau Nielsen oder
banjoseen.com. Interessanterweise sind Orchesternoten für Banjo fast immer
für Tenorbanjo geschrieben. Sogar Hans-Werner Henze hat in Jephte ein Tenorbanjo
vorgesehen.
Das
heutige Tenorbanjo ist bis auf Hals, Steg und Saitenhalter baugleich mit dem
Plektrumbanjo und fünfsaitigen Banjo, das heißt Felldurchmesser 11". Gestimmt
ist es aber in Quinten, CGDA
. Gespielt wird mit Plektrum. Eine Grifftabelle zum Tenorbanjo gibt
es bei
Ulrik Rathschau Nielsen oder
banjoseen.com. Interessanterweise sind Orchesternoten für Banjo fast immer
für Tenorbanjo geschrieben. Sogar Hans-Werner Henze hat in Jephte ein Tenorbanjo
vorgesehen.
Eine Variante des Tenorbanjos ist die "irische" Stimmung, eine Oktave unter der Geige, also GDAE. Näheres hierzu auf den Irish Banjo Seiten!
Einsatz: Klassischer Jazz, Tanzmusik 20er Jahre, Solo-Banjo, irische Musik
![]() Das
Ukulelebanjo wurde etwa 1918 unter dem Namen Banjulele von Alvin D. Keech zum
Patent angemeldet. Es weist mit 8" einen kleinen Kessel auf, auch der Hals mit
15 bis 17 Bünden ist eher kurz. Bespannt ist es mit Nylonsaiten und gespielt
wird es hauptsächlich mit Zeigefinger und Daumen, es wird also nicht gezupft.
Die absoluten Superseiten
zum Thema Ukulelebanjo hat Dennis Taylor aus England ins Netz gestellt. Da
bleibt keine Frage offen. Wer's lieber fernöstlich mag: in Japan gibt es eine
feine Grifftabelle
für die Ukulele. Ukulele & Co., werden in mehreren Stimmungen gespielt, die
Intervalle bleiben die gleichen: Quart - große Terz - Quart, also
ADF#H, aber auch GCEA oder BbEbGC.
Das
Ukulelebanjo wurde etwa 1918 unter dem Namen Banjulele von Alvin D. Keech zum
Patent angemeldet. Es weist mit 8" einen kleinen Kessel auf, auch der Hals mit
15 bis 17 Bünden ist eher kurz. Bespannt ist es mit Nylonsaiten und gespielt
wird es hauptsächlich mit Zeigefinger und Daumen, es wird also nicht gezupft.
Die absoluten Superseiten
zum Thema Ukulelebanjo hat Dennis Taylor aus England ins Netz gestellt. Da
bleibt keine Frage offen. Wer's lieber fernöstlich mag: in Japan gibt es eine
feine Grifftabelle
für die Ukulele. Ukulele & Co., werden in mehreren Stimmungen gespielt, die
Intervalle bleiben die gleichen: Quart - große Terz - Quart, also
ADF#H, aber auch GCEA oder BbEbGC.
![]() Wurde
angeblich von Vega erstmals unter diesem Namen angeboten. Mündete wohl in das
Little Wonder mit 17 Bünden. Offenbar gibt es nirgendwo einen Katalog dazu. Ein
kürzlich bei
Bernunzio
als Tango-Banjo angebotenes Instrument weist einen 11 ¼ Zoll Kessel ohne
Resonator, 17 Bünde bis zum Kessel sowie weitere 4 auf dem erweiterten
Griffbrett auf. Ein Foto der James
Reese Europe Band von 1914 zeigt demnach 2 Tango Banjos, die an so etwas wie
ein Cellobanjo gelehnt sind. Vielleicht war das Tango Banjo aber auch nur eine
Wortschöpfung der Werbeabteilung, die sich ein populäres Wort zu Nutzen
machte. Gestimmt wird das Tango-Banjo wie ein Tenorbanjo.
Wurde
angeblich von Vega erstmals unter diesem Namen angeboten. Mündete wohl in das
Little Wonder mit 17 Bünden. Offenbar gibt es nirgendwo einen Katalog dazu. Ein
kürzlich bei
Bernunzio
als Tango-Banjo angebotenes Instrument weist einen 11 ¼ Zoll Kessel ohne
Resonator, 17 Bünde bis zum Kessel sowie weitere 4 auf dem erweiterten
Griffbrett auf. Ein Foto der James
Reese Europe Band von 1914 zeigt demnach 2 Tango Banjos, die an so etwas wie
ein Cellobanjo gelehnt sind. Vielleicht war das Tango Banjo aber auch nur eine
Wortschöpfung der Werbeabteilung, die sich ein populäres Wort zu Nutzen
machte. Gestimmt wird das Tango-Banjo wie ein Tenorbanjo.
![]() Dieses
Instrument ist in Größe und Stimmung ein auf vier Saiten reduziertes
Mandolinenbanjo. Im Gegensatz zum sagenumwobenen Tangobanjo ist seine Existenz
in den 20er Jahren verbürgt, z.B. bei den Cliquot Club Eskimos. Die Kesselmaße
entsprechen exakt denen des Tenorbanjos vom selben Hersteller. Der Hals ist so
verkürzt, dass die Mensur einem am 7. Bund mit Kapo gespielten Tenorbanjo
entspricht (also zieht man Tenor-Saiten auf). Damit wäre nach 12 Bünden am
Kessel Schluss. Eine Oktave war dann aber doch zu wenig und so erweiterte man
das Griffbrett über den Kessel auf bis zu 19 Bünde.
Dieses
Instrument ist in Größe und Stimmung ein auf vier Saiten reduziertes
Mandolinenbanjo. Im Gegensatz zum sagenumwobenen Tangobanjo ist seine Existenz
in den 20er Jahren verbürgt, z.B. bei den Cliquot Club Eskimos. Die Kesselmaße
entsprechen exakt denen des Tenorbanjos vom selben Hersteller. Der Hals ist so
verkürzt, dass die Mensur einem am 7. Bund mit Kapo gespielten Tenorbanjo
entspricht (also zieht man Tenor-Saiten auf). Damit wäre nach 12 Bünden am
Kessel Schluss. Eine Oktave war dann aber doch zu wenig und so erweiterte man
das Griffbrett über den Kessel auf bis zu 19 Bünde.
![]() In
letzter Zeit erfreut sich das Cello Banjo wieder wachsender Beliebtheit, bei
Youtube tauchen mehrere
Beispiele
auf.
Gold Tone
baut Versionen mit 4 und 5 Saiten. Gestimmt werden sie eine Oktave unter dem
Tenor- bzw. 5-string Banjo. Der Kessel misst stolze 14" im Durchmesser. Der Hals
hat 16 Bünde.
In
letzter Zeit erfreut sich das Cello Banjo wieder wachsender Beliebtheit, bei
Youtube tauchen mehrere
Beispiele
auf.
Gold Tone
baut Versionen mit 4 und 5 Saiten. Gestimmt werden sie eine Oktave unter dem
Tenor- bzw. 5-string Banjo. Der Kessel misst stolze 14" im Durchmesser. Der Hals
hat 16 Bünde.
War in den 20ern ein absoluter Exote. Die Spielbarkeit ist nicht verbürgt, der Druck der Saiten dürfte für die normale Banjobauweise zu hoch sein. Trotzdem probieren es heute erstaunlich viele Leute, ein Bassbanjo herzustellen: Bass Banjo, Garrison String Bass Banjo, Gold Tone - Bass Banjo, 'Jo Bass the banjo bass, Bass Banjos, Banjo Bass. Die Kesseldurchmesser beginnen bei 13", der Hals erreicht die Dimensionen eines ausgewachsenen Kontrabasses.
Einsatz: abgesehen vom Ukulele Banjo, das gelegentlich solistisch und zur Gesangsbegleitung eingesetzt wird, haben diese Banjos heute keine Bedeutung mehr.
![]() Patentiert
schon 1885 unter der Bezeichnung Banjolin. Das Mandolinenbanjo (banjo
mandolin) ist wie eine Mandoline gestimmt, also GDAE. Jeweils zwei
benachbarte Saiten werden gleich gestimmt. Durch das über den Kessel verlängerte
Griffbrett sind trotz des nur 7" kurzen Halses bis zu 19 Bünde möglich. Die
Kesseldurchmesser variieren stark und liegen im Bereich von 7 bis 10¼ Zoll. Wie
die Mandoline wird das Mandolinenbanjo mit dem Plektrum gespielt.
Patentiert
schon 1885 unter der Bezeichnung Banjolin. Das Mandolinenbanjo (banjo
mandolin) ist wie eine Mandoline gestimmt, also GDAE. Jeweils zwei
benachbarte Saiten werden gleich gestimmt. Durch das über den Kessel verlängerte
Griffbrett sind trotz des nur 7" kurzen Halses bis zu 19 Bünde möglich. Die
Kesseldurchmesser variieren stark und liegen im Bereich von 7 bis 10¼ Zoll. Wie
die Mandoline wird das Mandolinenbanjo mit dem Plektrum gespielt.
Einsatz: Banjoorchester, Soloinstrument
![]() Die
Banjoline ist eigentlich kein Banjo. Weil sie von Eddie Peabody erfunden wurde,
soll sie hier erwähnt werden. Es handelt sich um eine halbakustische E-Gitarre
mit 6 Saiten, durch die Peabodys Glissandi nach Hawaiigitarre klangen. Stimmung
und Hals waren die eines Plektrumbanjos (das Peabody ja bevorzugt spielte),
wobei die beiden tiefen Saiten verdoppelt waren, die C Saite als Oktavparallele.
Banjolinen wurden für eine kurze Zeit von Rickenbacker verkauft. Die
Namensgleichheit mit der Erfindung von 1885 spielte 1968 wohl keine Rolle mehr.
Die
Banjoline ist eigentlich kein Banjo. Weil sie von Eddie Peabody erfunden wurde,
soll sie hier erwähnt werden. Es handelt sich um eine halbakustische E-Gitarre
mit 6 Saiten, durch die Peabodys Glissandi nach Hawaiigitarre klangen. Stimmung
und Hals waren die eines Plektrumbanjos (das Peabody ja bevorzugt spielte),
wobei die beiden tiefen Saiten verdoppelt waren, die C Saite als Oktavparallele.
Banjolinen wurden für eine kurze Zeit von Rickenbacker verkauft. Die
Namensgleichheit mit der Erfindung von 1885 spielte 1968 wohl keine Rolle mehr.
Einsatz: Eddie Peabody Stil
![]() Dieses
Banjo ist weitaus seltener anzutreffen als seine fünf- oder viersaitigen
Vettern. Bekannt ist, dass Johnny St. Cyr bei Louis Armstrongs Hot Five und Hot
Seven auch Gitarrenbanjo spielte. Der Hals hat 22 Bünde, der Felldurchmesser ist
11-12", die Stimmung EADGHE, wie eine Gitarre,
gelegentlich auch um ½ Ton tiefer oder höher, was besser zu den B-Tonarten
passt. Gespielt wird es mit Plektrum.
Dieses
Banjo ist weitaus seltener anzutreffen als seine fünf- oder viersaitigen
Vettern. Bekannt ist, dass Johnny St. Cyr bei Louis Armstrongs Hot Five und Hot
Seven auch Gitarrenbanjo spielte. Der Hals hat 22 Bünde, der Felldurchmesser ist
11-12", die Stimmung EADGHE, wie eine Gitarre,
gelegentlich auch um ½ Ton tiefer oder höher, was besser zu den B-Tonarten
passt. Gespielt wird es mit Plektrum.
Einsatz: Dixieland, U-Musik, wenn der Gitarrist nach Banjo klingen soll.
Es gibt noch zahlreiche weitere Banjotypen. In England gab es beispielsweise das sogenannte Zitherbanjo, dessen fünfte Saite nicht am Hals ansetzte, sondern wie die anderen Saiten in der Kopfplatte begann. Sie wurde im Hals geführt und erschien erst am 5. Bund an der Oberfläche. Daneben gab es weitere Ausführungen mit bis zu sieben Saiten.
Zur Beantwortung dieser Frage gibt es ein kleines Expertensystem als Java Applet, das die Bestimmung des Banjos aus einigen elementaren Angaben (Saitenzahl und -länge, Bünde, Kesseldurchmesser, ...) erlauben soll. Die meisten hier vorgestellten Banjotypen werden dort erkannt.